
Die in der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) zusammengeschlossenen, bundesweit tätigen Verbände der Sucht-Selbsthilfe
- Blaues Kreuz in Deutschland e. V.,
- Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband e. V.,
- Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe – Bundesverband e. V.,
- Guttempler in Deutschland e. V. und
- Kreuzbund e. V.
begleiten mit einer Vielzahl an niedrigschwelligen Hilfeangeboten Menschen auf ihrem Weg in ein suchtfreies Leben. Vor, während und nach professioneller therapeutischer und medizinischer Hilfe sowie unabhängig davon, können die Betroffenen von diesen Möglichkeiten profitieren.
Die bundesweit tätigen SuchtSelbsthilfeverbände bieten in über 6.000 Selbsthilfegruppen Hilfe an und halten zahlreiche digitale Möglichkeiten für Hilfesuchende bereit, sich auszutauschen oder beraten zu lassen. 1 Auch wenn diese Fülle unterschiedlichster Angebote für Hilfesuchende suchtmittelübergreifend ist, so ist das legale Suchtmittel Alkohol nach wie vor von größter Bedeutung. Gerade die Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und Allgegenwärtigkeit alkoholischer Produkte macht es Menschen schwer, alkoholfrei zu leben. Es ist das am häufigsten konsumierte psychoaktive Suchtmittel in Deutschland und das einzige, dessen Konsum gesellschaftlich weitgehend akzeptiert ist und bei vielen Gelegenheiten oft sogar erwartet wird. Alkohol kann nicht nur abhängig machen, sondern ist insgesamt gesundheitsschädlich. Über 200 Erkrankungen sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen, sodass dadurch der Gesundheitsstatus der Gesellschaft insgesamt negativ beeinflusst wird.
Die Sucht-Selbsthilfeverbände beschränken sich daher nicht auf die Unterstützung und Hilfe für die Einzelperson, sondern nehmen auch Einfluss auf gesellschaftliche und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen, um Menschen vor gesundheitlichen Schäden zu schützen und ihnen ein suchtmittelfreies Leben zu ermöglichen.
Unsere Forderungen
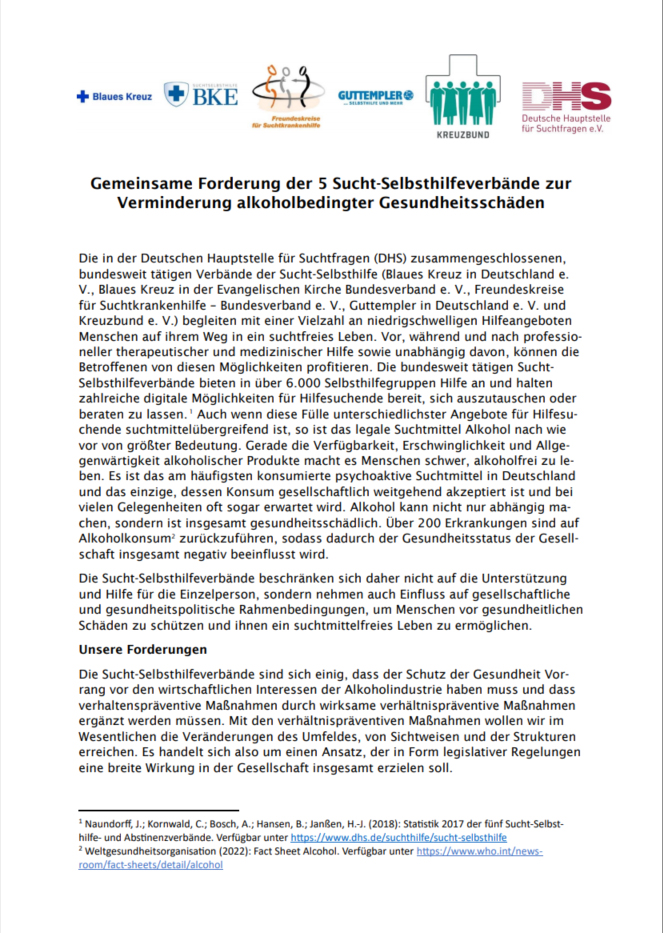
Die Sucht-Selbsthilfeverbände sind sich einig, dass der Schutz der Gesundheit Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen der Alkoholindustrie haben muss und dass verhaltenspräventive Maßnahmen durch wirksame verhältnispräventive Maßnahmen ergänzt werden müssen. Mit den verhältnispräventiven Maßnahmen wollen wir im Wesentlichen die Veränderungen des Umfeldes, von Sichtweisen und der Strukturen erreichen. Es handelt sich also um einen Ansatz, der in Form legislativer Regelungen eine breite Wirkung in der Gesellschaft insgesamt erzielen soll.
Die Umsetzung solcher Maßnahmen ist in der Europäischen Union noch wenig verbreitet und liegt in Deutschland zusätzlich noch deutlich unter dem Standard der europäischen Nachbarländer. Unsere Forderungen basieren sowohl auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch auf den Erfahrungen unserer Mitglieder und der Hilfesuchenden, die unsere Selbsthilfeangebote in Anspruch nehmen. Sie orientieren sich an der Alkoholstrategie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und zielen auf wirksame und rechtlich verbindliche Rahmenbedingungen ab, um den Alkoholkonsum insgesamt und seine gesundheitsschädlichen Folgen in Deutschland zu reduzieren. Wir halten folgende Regelungen für dringend erforderlich:
Höhere Steuern führen zu höheren Preisen und schaffen Anreize, weniger Alkohol zu trinken. Dies gilt nachweislich auch für Menschen, die häufig Alkohol konsumieren. Eine deutliche Erhöhung der Verbrauchssteuern und eine einheitliche Besteuerung aller alkoholischen Produkte auf Basis des Alkoholgehalts, unabhängig von der Art des Getränks, ist notwendig. Letzteres verhindert, dass die Konsument*innen auf billigere Produkte ausweichen.
Alkoholische Getränke sind weder Lebensmittel noch lebensnotwendig und müssen daher nicht rund um die Uhr erhältlich sein. Wir halten daher Regelungen für erforderlich, die den Verkauf und die ständige Verfügbarkeit einschränken. So kann die Verfügbarkeit von Alkohol dadurch verringert werden, indem das Mindestalter für die Abgabe aller alkoholischen Getränke auf 18 Jahre angehoben wird und der Verkauf in abgetrennten Bereichen mit obligatorischer Alterskontrolle erfolgt. Darüber hinaus sollten die Verkaufszeiten für alkoholische Getränke deutlich eingeschränkt werden und der Verkauf nicht an Orten stattfinden, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Letzteres würde dazu beitragen, dass Menschen mit Alkoholproblemen sichere Orte zum Einkaufen finden.
Werbung fördert den Verkauf von alkoholischen Getränken, was zu einer Zunahme des Konsums in der Gesellschaft und damit auch zu einer Zunahme der gesundheitlichen Folgen führt. Die Präsenz von Alkoholwerbung im öffentlichen Raum in Deutschland ist enorm. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen der Menge an Werbung und dem früheren Beginn des Alkoholkonsums bei Jugendlichen. Darüber hinaus sind Menschen mit einer Alkoholkonsumstörung sowie Menschen, die versuchen, ihre Abhängigkeitserkrankung zu überwinden und noch rückfallgefährdet sind, besonders anfällig für Alkoholwerbung. Werbebeschränkungen für Alkohol sollten auch für alkoholarme und alkoholfreie Produkte unter Markennamen gelten, die von alkoholhaltigen Produkten geführt werden. Die Industrie wirbt für alkoholfreie Marken, die fast identisch mit alkoholischen Marken sind, um Regulierungen zu umgehen. Dadurch wird jedoch das alkoholische Produkt genauso beworben wie das alkoholfreie Produkt, das in der Regel einen wesentlich geringeren Anteil am Gesamtabsatz hat.
In Deutschland gibt es derzeit keine generelle Warnhinweispflicht für alkoholhaltige Getränke. Die Lebensmittelverordnung schreibt lediglich die Angabe des Alkoholgehalts bei verpackten Getränken mit mehr als 1,2 Volumenprozent Alkohol vor. Warnhinweise zu den gesundheitlichen Risiken des Alkoholkonsums auf allen Verpackungen alkoholischer Getränke fördern die Gesundheitskompetenz und tragen dazu bei, das Bewusstsein für die Risiken des Alkoholkonsums zu schärfen und den Konsum zu reduzieren. Stündlich wird in Deutschland ein Kind mit unheilbaren Alkoholschäden (FASD) geboren, dem mit entsprechenden gut sichtbaren Warnhinweisen für Schwangere auf jedem alkoholhaltigen Getränk begegnet werden kann.
Darüber hinaus fordern wir eine generelle Kennzeichnung des Alkoholgehalts von Getränken und Lebensmitteln, um unerwünschtem Alkoholkonsum vorzubeugen. Unerwünschter Alkoholkonsum betrifft nicht nur die Ernährung von Kindern, sondern auch Schwangere und suchterkrankte Menschen, bei denen schon kleinste Mengen und der Geruch von Alkohol zu Rückfällen führen können.
Hintergründe
Entgegen weit verbreiteter Annahmen zeigen Studienergebnisse, dass es keinen harmlosen und schon gar keinen gesundheitsfördernden Alkoholkonsum gibt.
In der Alkoholprävention stand lange Zeit die Verhinderung von sogenanntem »Missbrauch« oder Abhängigkeit durch Maßnahmen zur Veränderung des Verhaltens von Individuen im Vordergrund. In den letzten Jahren haben jedoch verhältnispräventive Maßnahmen an Bedeutung gewonnen. Sie zielen auf die Kontrolle, Verringerung oder Beseitigung von Gesundheitsrisiken ab und nehmen Einfluss auf gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass verhältnispräventive Maßnahmen besonders wirksam sind, um Einstellung und Verhalten im Umgang mit Alkohol zu beeinflussen. Sie sind kostengünstig und führen zu einer Verringerung des Alkoholkonsums und der damit einhergehenden Gesundheitsschäden. Die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation sehen Verhältnisprävention als die wichtigste Maßnahme, um Alkoholerkrankungen zu vermeiden. Sie empfehlen unter anderem die Besteuerung von Alkoholprodukten, um die Preise zu erhöhen, die Beschränkung der Verfügbarkeit und Verbote beziehungsweise umfassende Einschränkungen für Werbung, Marketing und Sponsoring. Deutschland belegt im europäischen Vergleich häufig hintere Plätze, wenn es um Maßnahmen und Gesetze gegen durch Alkoholkonsum verursachte Schäden geht: Deutschland tut sich schwer damit, Alkohol angemessen zu verteuern und seine ständige Verfügbarkeit einzuschränken.
Die Alkoholindustrie präsentiert sich als verantwortungsbewusste Branche, welche auf Selbstverantwortlichkeit und Selbstregulierung setzt. Mit unterschiedlichen Strategien versucht sie in Deutschland, Europa und weltweit durch ihre Lobbyarbeit wirksame verhältnispräventive Maßnahmen zur Alkoholpolitik zu verhindern. Sie stellt die Rechtmäßigkeit von Regulierungsmaßnahmen wie Altersbeschränkungen, Werbeverbote oder Steuererhöhungen für alkoholische Produkte in Frage und verhindert oder verzögert damit wichtige Ansätze zur Verhältnisprävention. Wissenschaftliche Studien, die die negativen Folgen des Alkoholkonsums auf die Gesundheit und die Gesellschaft herunterspielen oder anzweifeln, werden von Alkoholherstellern unterstützt.
Alkoholbedingte Krankheiten sind vermeidbare Krankheiten und dennoch gelingt es der Alkoholindustrie, ihre eigenen kommerziellen Interessen gegen wirksamen Gesundheitsschutz und wirksame Maßnahmen der Gesundheitsförderung durchzusetzen und zu festigen. Diese Einflüsse der Alkoholindustrie auf die menschliche Gesundheit werden als kommerzielle Determinanten der Gesundheit (Commercial Determinants of Health, CDoH) bezeichnet. Sie verursachen Gesundheitsschäden, deren Kosten jedoch auf die Gesellschaft abgewälzt werden.
Fazit
Aus all den genannten Gründen fordern die Verbände die zeitnahe Umsetzung der beschriebenen alkoholpolitischen Maßnahmen, um die individuellen und gesellschaftlichen Schäden, die durch Alkohol verursacht werden, zu verringern.

