
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Gesundheit der Menschheit. Von Überschwemmungen und Buschbränden bis hin zu Artensterben, Umweltverschmutzung und der Ausbreitung von Krankheiten – es wird immer schwieriger, die Auswirkungen unseres rasanten Konsums und der ihn unterstützenden Industrien auf die Umwelt zu ignorieren.
Die Herstellung, der Vertrieb und der Konsum vieler schnelllebiger Konsumgüter tragen erheblich zum Klimawandel bei, vor allem durch die Freisetzung von Treibhausgasen. Alkohol ist da keine Ausnahme. Untersuchungen des Water Footprint Network haben ergeben, dass für die Herstellung von 1 Liter Wein rund 870 Liter Wasser benötigt werden. Bei der Herstellung von 1 Liter Bier werden schätzungsweise zwischen 510 und 842 Gramm CO2 freigesetzt. Schätzungen hängen oft von der Herstellung der Verpackung ab, die erhebliche CO2-Emissionen verursacht. So werden die Emissionen aus der Herstellung von Bierdosen allein in Großbritannien auf über 340.000 Tonnen CO2 pro Jahr geschätzt.
Der Klimawandel kann sich auch auf den Konsum auswirken. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung ergab, dass klimawandelbedingte Ereignisse wie Hurrikane und Brände unter bestimmten Umständen mit einem erhöhten Substanzkonsum und einer erhöhten Nachfrage nach Dienstleistungen einhergingen, neben Veränderungen in der Verfügbarkeit von Drogen und Unterbrechungen der Dienstleistungen. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass diese Auswirkungen ungleich verteilt sind:
… die Auswirkungen des Klimawandels auf den Konsum von Alkohol und anderen Drogen sind in hohem Maße kontextabhängig und situativ und reagieren auf Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arten von klimawandelbedingten Gefahren, sozioökonomischen Schwachstellen und materiellen Bedingungen, die an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit vorliegen.«
Wichtig ist, dass hier viel getan werden kann. Politische Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen aus Verkehr, Konsum und anderen Formen des Energieverbrauchs haben das Potenzial, erhebliche gesundheitliche Vorteile mit sich zu bringen.
Angesichts dieser potenziellen positiven Nebeneffekte diskutieren wir in unserem aktuellen Kommentar, wie wichtig es ist, die Evidenzbasis für die kommerziellen Determinanten der Alkoholindustrie zu stärken, Ungleichheiten zu beseitigen und Produktempfehlungen zu geben, um Alkoholkonsument*innen zu helfen, sich für kohlenstoffärmere Optionen zu entscheiden. Als Forschende im Bereich der öffentlichen Gesundheit verfügen wir bereits über das methodische Wissen und die Erfahrung, um die notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für die Regulierung und die Bemühungen von Alkoholproduzent*innen und Konsument*innen dienen können, ihren Beitrag zu Umweltschäden zu minimieren. Wir können zum Beispiel Daten über den Wasserverbrauch, die Abholzung, die Bodenverarmung und den Energieverbrauch bei der Alkoholproduktion sammeln. Wir können die Umweltschäden dokumentieren, die durch die Produktion, den Konsum und die Entsorgung von Alkohol für die Gesundheit der Menschen und den Planeten entstehen. Nach der zunehmenden Erforschung der Lobbying-Strategien der Alkoholindustrie könnten Gesundheitsforscher*innen auch die Aktivitäten der Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung untersuchen, bei denen die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und das Umweltverhalten der Industrie eine wichtige Rolle spielen. Schließlich können wir das Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen den Umweltauswirkungen von Alkohol und seinen gesundheitlichen Folgen schärfen und die Verbraucher*innen dabei unterstützen, sich für Alkoholprodukte zu entscheiden, die weniger CO2 erzeugen.
Frühere und aktuelle Ansätze zur Reduzierung des Alkoholkonsums beinhalten oft die Hervorhebung der individuellen Gesundheitsschäden durch den Konsum, die Betonung der Schäden für andere durch Ereignisse wie Verkehrsunfälle und die Verteuerung von Alkohol auf der Grundlage des Alkoholgehalts der Produkte. Unseres Wissens gibt es keine Alkoholinterventionen, die die Umweltschäden durch Alkoholkonsum hervorheben, um zu einer Reduzierung des Konsums zu motivieren. Dies gilt trotz der Tatsache, dass Umweltbelange nachweislich ein wichtiger Motivator für andere Arten von Verhaltensänderungen sind, darunter auch Kaufentscheidungen. Die Hervorhebung der Umweltbelastungen durch Alkohol im Rahmen von Interventionen könnte eine ungenutzte Möglichkeit sein, den gesundheitlichen Schäden durch Alkoholkonsum entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind diese Ergebnisse synergistisch – Klimabedenken können genutzt werden, um bessere Konsumentscheidungen zu fördern, und gleichzeitig kann die Förderung eines kohlenstoffarmen und umweltbewussten Alkoholkonsums mit gesundheitlichen Vorteilen einhergehen, darunter eine Entlastung unseres Gesundheits- und Rettungswesens.
Schließlich liegt die Verantwortung für die Alkoholpolitik bei den Regierungen auf verschiedenen Ebenen und sollte nicht nur in den Zuständigkeitsbereich der Gesundheitsbehörden fallen. Unternehmen, die Alkohol herstellen, widersetzen sich Maßnahmen, die ihre Gewinne schmälern, selbst wenn die schädlichen Auswirkungen des Alkohols offensichtlich sind. Die Bekämpfung des Beitrags schnelllebiger Konsumgüter wie Alkohol zum Klimawandel erfordert eine globale, sektorübergreifende und innerstaatliche Koordinierung.
Während die Diskussion über die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelkonsums auf das Klima relativ weit verbreitet ist, wird der Beitrag von Alkohol zur Umweltzerstörung selten berücksichtigt. Die Alkoholpolitik und ‑regulierung sollte Maßnahmen zur Verringerung der Umweltzerstörung und der CO2-Emissionen durch die Herstellung und den Konsum von Alkohol umfassen. Dies würde nicht nur den Klimawandel abmildern, sondern auch Vorteile für die Gesundheit des Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt mit sich bringen.
Verfasst von Dr. Megan Cook und Professor Sarah MacLean, Zentrum für Alkoholpolitikforschung (CAPR), Fakultät für Psychologie und öffentliche Gesundheit, La Trobe University.
Weniger Alkohol schützt auch den Planeten

Laut einer neuen Studie unter der Leitung der Harvard T. H. Chan School of Public Health haben Menschen, die alkoholfrei leben oder nur geringe Mengen Alkohol zu sich nehmen, ein geringeres Risiko, vorzeitig zu sterben, und belasten die Umwelt weniger. Es handelt sich um die erste große Studie, die direkt die Auswirkungen der Befolgung der Empfehlungen des grundlegenden EAT-Lancet-Berichts 2019 untersucht.
Hitzewellen und Klimawandel können zur Zunahme von Drogen- und Alkoholkrankheiten beitragen
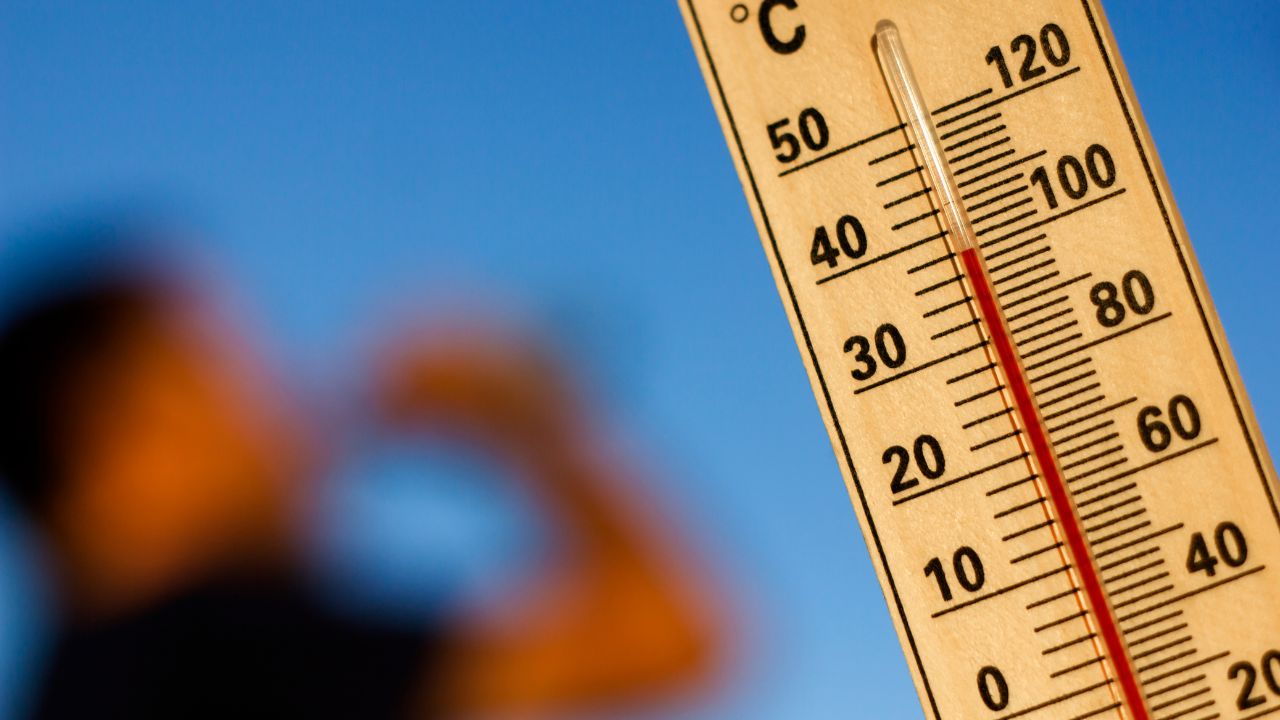
Forscher*innen der Columbia Public Health haben herausgefunden, dass substanzkonsumbedingte Krankenhausaufenthalte zum Teil auf höhere Temperaturen zurückzuführen sind, und dass der Klimawandel das Problem noch verschärfen könnte.
Quelle: Institute of Alcohol Studies
Übersetzt mit www.DeepL.com

