
Alkohol ist nach wie vor bei vielen akademischen und öffentlichen Gesundheitsveranstaltungen, von Networking-Empfängen bis hin zu Konferenzdinner, die Regel. Immer mehr Fachleute fühlen sich jedoch mit dieser Norm unwohl und sehen darin einen Widerspruch zu den Werten der öffentlichen Gesundheit.
Die »Sober Science«-Erfahrung auf einer Alkoholforschungskonferenz in Schottland
Im Jahr 2023 gründeten die Europäische Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Europäische Union im Rahmen des Projekts »Evidence into Action Alcohol« (EVID-Action) das Early Career Researcher (ECR) Network, um eine neue Generation von Forscher*innen zu fördern, die sich mit Alkoholpolitik befassen. Im Laufe der Diskussionen unter den 26 jungen Fachleuten begann die Gruppe, kulturelle und berufliche Normen in Bezug auf den Alkoholkonsum in Frage zu stellen. »Wenn wir uns für die öffentliche Gesundheit und evidenzbasierte Alkoholpolitik einsetzen, warum dreht sich dann in unseren beruflichen Bereichen immer noch alles um Alkohol?«, erinnert sich Jelena Dunaiceva, ein Mitglied des ECR-Netzwerks aus Lettland.
Diese Überlegungen veranlassten die Gruppe, »Sober Science« ins Leben zu rufen, eine Nebenveranstaltung des 50. Kettil-Bruun-Society-Symposiums (KBS), dem weltweit größten Treffen von Forscher*innen im Bereich Alkoholpolitik. Die Veranstaltung am 8. Juni 2025 bot Nachwuchswissenschaftler*innen die Möglichkeit, über die Rolle von Alkohol in akademischen und gesundheitspolitischen Kontexten nachzudenken und diese zu überdenken.
Es begann mit einem leisen Unbehagen, das viele von uns seit Jahren empfanden – wir bemerkten, wie oft in beruflichen Umgebungen, sogar im Gesundheitswesen, Alkohol zum Standard wurde. Wir wollten etwas anderes anbieten. KBS mit seinem Ruf als offenes und freundliches Netzwerk schien uns der perfekte Ort dafür zu sein«, erklärt Francisca Pulido Valente, ein ECR-Netzwerkmitglied aus Portugal.
Sechs Mitorganisator*innen, inspiriert von der Kampagne »Redefine Alcohol« der WHO/Europa, gründeten »Sober Science« als einen integrativen, alkoholfreien Raum, um zu zeigen, dass auch ohne Alkohol sinnvolle berufliche und persönliche Beziehungen geknüpft werden können.
Planung mit Fakten und Absicht
Als die Idee von »Sober Science« Gestalt annahm, wurde den Organisator*innen klar, dass ihr Ziel nicht einfach darin bestand, auf persönliches Unbehagen zu reagieren, sondern eine Veranstaltung zu konzipieren, die auf evidenzbasierten Prinzipien für inklusive, sichere und gesundheitsorientierte professionelle Räume und Veranstaltungen beruht.
Alkohol wird oft als harmlose Möglichkeit angesehen, Kontakte zu knüpfen. In Wirklichkeit kann er jedoch informelle Hierarchien verstärken und dazu führen, dass sich manche Menschen ausgeschlossen fühlen – insbesondere Nachwuchsforscher*innen, Frauen, Menschen in der Genesungsphase oder Menschen aus Kulturen oder Religionen, in denen Alkoholkonsum nicht gern gesehen ist. Umfragen spiegeln diese Spannung wider: Viele Wissenschaftler*innen geben an, dass sie sich beim Alkoholkonsum bei beruflichen Veranstaltungen unwohl fühlen oder unsicher sind, wo sie die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit ziehen sollen, während andere sich aufgrund von äußerem Druck und der Angst vor Stigmatisierung zum Alkoholkonsum gezwungen fühlen. Während einige ein vollständiges Verbot fordern, äußern viele den Wunsch nach Veränderung.
Auch Institutionen beginnen sich zu fragen, ob Alkohol bei jeder Zusammenkunft ein fester Bestandteil sein muss. Diese Diskussionen wurden beispielsweise bereits innerhalb des breiter angelegten EVID-Action ECR-Netzwerks geführt.
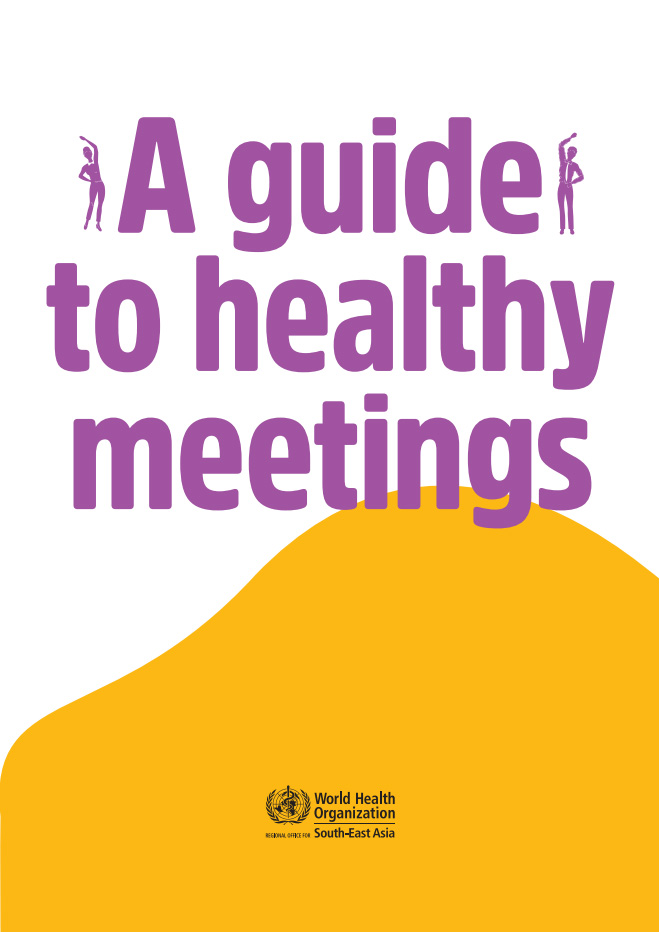
Mit Unterstützung der WHO/Europa und des KBS25-Organisationskomitees plante das Team die Veranstaltung anhand des WHO-Leitfadens für gesunde Meetings und wählte einen gut beleuchteten, einladenden Veranstaltungsort an der Universität Glasgow. Die Getränkekarte bot eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken – nicht nur Wasser – und das Essen war sowohl für Veganer*innen als auch für Nicht-Veganer*innen geeignet. Das Format wurde bewusst so gestaltet, dass es zu Bewegung und Interaktion anregte und eine dynamischere Umgebung schuf. Wichtig ist, dass die Veranstaltung nicht als Ablehnung von Alkohol konzipiert war, sondern als Einladung, auf andere Weise miteinander in Kontakt zu treten.
Eine Substanz, die derart weitreichende Schäden verursachen kann, ist für eine Organisation, die sich der Förderung der öffentlichen Gesundheit verschrieben hat, oder für eine Institution, die sich für die Gesundheitsförderung einsetzt, nicht geeignet.«
A Guide to Healthy Meetings
Anastasia Månsson aus Schweden, Mitorganisatorin der Veranstaltung, reflektierte über den Ansatz und erklärte: »Anfangs waren wir versucht, das Thema zu sehr zu intellektualisieren, aber wir haben uns daran erinnert, dass Inklusion nichts Abstraktes ist. Es geht darum, was auf dem Tisch steht, wer im Raum ist und wie sich dieser Raum anfühlt. Es ging nicht um Verbote, sondern darum, eine Alternative zu schaffen, die neue Normen inspirieren könnte, insbesondere für jüngere Forscher*innen.«
Wie »Sober Science« in der Praxis aussah
Am Abend vor Beginn der KBS25 fand die Veranstaltung »Sober Science« statt, an der rund 50 Teilnehmer*innen teilnahmen – hauptsächlich Nachwuchswissenschaftler*innen, begleitet von 11 erfahrenen Kolleg*innen, die als Mentor*innen fungierten.
Die Sitzung begann informell. Die Teilnehmer*innen wurden mit dem ECR EVID-Action Network und den Moderator*innen bekannt gemacht, während sie Speisen und eine Auswahl alkoholfreier Getränke genossen. Um die Unterhaltung anzuregen, erhielten die Teilnehmer*innen einen »Networking-Pass« – ein Spiel im Bingo-Stil mit Fragen wie »hat über Alkoholpolitik veröffentlicht« oder »nimmt zum ersten Mal am KBS teil«. In einer kurzen Präsentation wurden dann der Zweck der Sitzung und ihr Zusammenhang mit breiteren Diskussionen über Inklusion und kulturellen Wandel im beruflichen Umfeld dargelegt. Viele Teilnehmer*innen gaben später an, dass ihnen dieser Kontext geholfen habe, zu verstehen, wie die Veranstaltung Teil eines größeren Wandels im Denken sei.
Um einen offenen Dialog zu fördern, nahm die Gruppe an einer interaktiven »menschlichen Umfrage« teil. Anstatt anonym per Telefon zu antworten, reagierten die Teilnehmer*innen physisch. Als eine Aussage wie »Nur weil ich als Alkohol-Forscher*in tätig bin, heißt das nicht, dass ich auf Konferenzen keinen Alkohol trinken sollte« vorgelesen wurde, bewegten sich die Teilnehmer*innen im Raum, um ihre Position auf einer Skala von »stimme voll und ganz zu« bis »stimme überhaupt nicht zu« anzuzeigen, wobei Raum für differenziertere Zwischenpositionen blieb.
Es war erfrischend zu sehen, wie Berufseinsteiger*innen und erfahrene Kolleg*innen ohne Leistungsdruck miteinander in Kontakt traten. Die Menschen hörten einfach zu und lernten voneinander – und das funktionierte, ohne dass auch nur ein Tropfen Alkohol floss.«
Martins Zvackis, Lettland
Die Norm verändern, indem man zeigt, was möglich ist
Das Feedback von Sober Science war überwältigend positiv. Im Abschlusskreis beschrieben die Teilnehmer*innen, wie viel Druck sie oft unbewusst in alkoholzentrierten Umgebungen verspürt hatten und wie dieser Druck in einer inklusiven, alkoholfreien Umgebung nachließ. Für viele war es das erste Mal, dass sie offen über diese Spannungen im akademischen Umfeld gesprochen hatten.
Besonders auffällig war, dass die Vorteile nicht nur für Nachwuchswissenschaftler*innen galten, sondern dass die Erfahrung für alle Teilnehmer*innen eine erfrischende Abwechslung darstellte. Sober Science hat gezeigt, dass Alkohol in beruflichen Umgebungen nicht neutral ist und dass alkoholfreie Alternativen dennoch sinnvolle Verbindungen fördern können.
Kulturwandel beginnt damit, Dinge anders zu machen – und sei es nur einmal.«
Elena Torrell, Spanien
Matt Lesch aus Kanada fügte hinzu: »Mit Sober Science wollten wir sagen: Bei Veranstaltungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gibt es auch einen anderen Weg.«
WHO Europa startet Kampagne »Redefine Alcohol« mit Schwerpunkt auf versteckten Risiken wie Krebs

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Europa hat eine neue Kampagne mit dem Titel »Redefine Alcohol« (Alkohol neu definieren) gestartet, die vom 2. Oktober bis zum 30. November 2024 laufen wird.
Quelle: WHO Europa
Übersetzt mit www.DeepL.com

