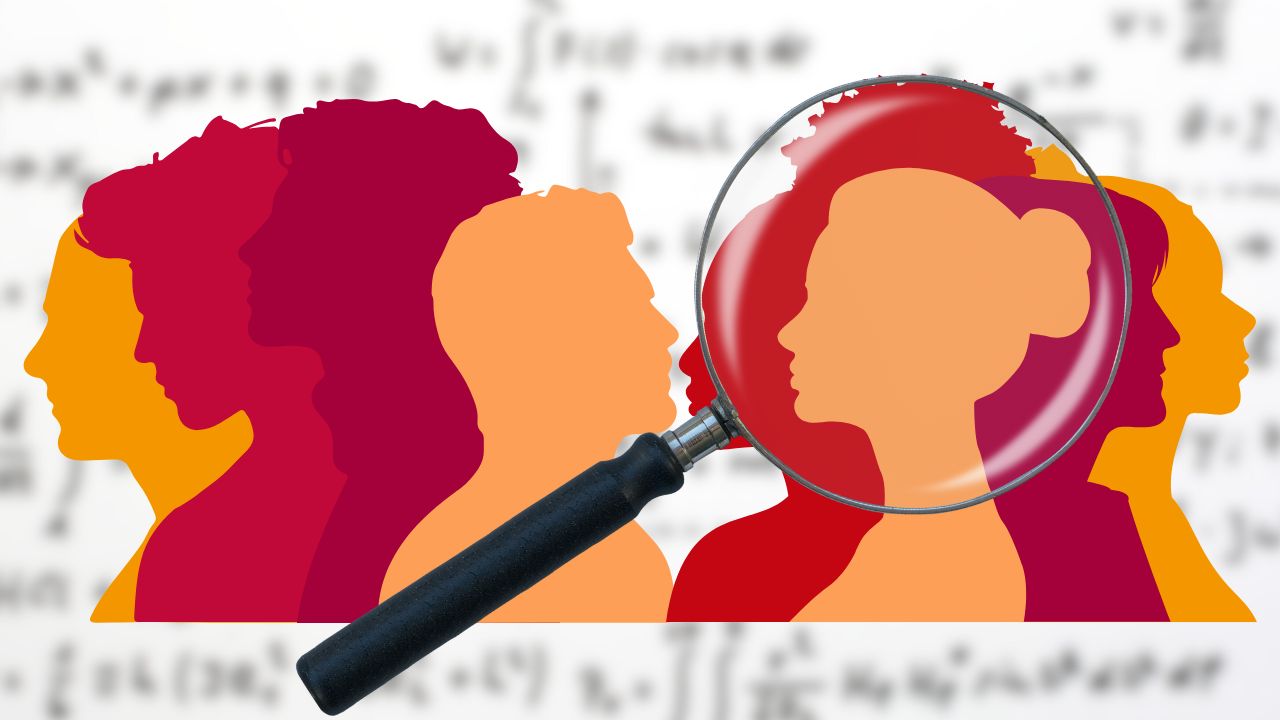
Männer konsumieren mehr Alkohol und erleiden häufiger alkoholbedingte Schäden als Frauen. Eine aktuelle Auswertung von 1.267 geschlechtsspezifischen Alkoholstudien durch ein Forschungsteam der La Trobe University in Australien ergab jedoch, dass in den letzten zehn Jahren (2014 – 2023) mehr Zeitschriftenartikel über den Alkoholkonsum von Frauen als von Männern veröffentlicht wurden. Das heißt, obwohl Männer tendenziell mehr Alkohol konsumieren, hat sich die aktuelle Alkoholforschung stärker auf Frauen konzentriert.
Weitere wichtige Ergebnisse sind, dass es insgesamt nur sehr wenige qualitative Studien gibt (insbesondere zu Männern), dass ein besonders starker Fokus auf junge Frauen (18 – 24 Jahre) liegt und dass der Anteil der Studien zu Müttern deutlich höher ist als der zu Vätern. Die Forscher*innen stellten außerdem fest, dass es mehr medizinische Studien zu Männern als zu Frauen gibt – ein Ergebnis, das nicht nur für Alkohol gilt. Umgekehrt stammten Studien zu Frauen eher aus den Bereichen Psychologie, öffentliche Gesundheit oder Soziologie. Dies deutet darauf hin, dass Forscher*innen sich in Bezug auf Alkohol eher für die Gesundheit von Männern und das Verhalten von Frauen interessieren. Das Team argumentiert, dass Forscher*innen offenbar daran interessiert sind, die Auswirkungen von Alkohol auf den Körper von Männern zu verstehen und zu ergründen, warum Frauen so trinken, wie sie trinken, wobei sie Frauen implizit für ihren Alkoholkonsum verantwortlich machen, was bei Männern nicht der Fall ist. Ein Beispiel hierfür ist die Problematisierung des Verhaltens von Frauen aufgrund der Schädigung von Kindern, ohne dabei die Rolle der Männer bei der Kinderbetreuung, bei der Schädigung von Kindern und sogar bei alkoholbelasteten Schwangerschaften anzuerkennen.
In Australien und Großbritannien stellten die Forscher*innen große Diskrepanzen fest zwischen denjenigen, die laut nationalen Schätzungen am stärksten unter alkoholbedingten Schäden leiden (Männer), und denjenigen, die von Alkoholforscher*innen untersucht werden (Frauen). Es gab auch mehr Studien, die den Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum von Frauen und der Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Gewalttat zu werden, untersuchten, als solche, die den Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum von Männern und der Gewalttätigkeit gegenüber anderen untersuchten. Dies unterstreicht die Annahme, dass Frauen eher für Übergriffe gegen sie selbst verantwortlich gemacht werden als Männer.
Warum ist das wichtig?
Diese Untersuchung liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie die Entscheidungen von Forscher*innen darüber, wen sie untersuchen und wie sie dies tun, unsere Sichtweise auf den Alkoholkonsum von Männern und Frauen beeinflussen können. Dies kann wiederum politische Maßnahmen, Interventionen und Behandlungen zur Verringerung alkoholbedingter Schäden beeinflussen oder verändern. Es kann auch die geschlechtsspezifische Art und Weise beeinflussen, wie Alkohol in den Medien diskutiert und dargestellt wird. Wenn beispielsweise der Alkoholkonsum von Frauen im Zusammenhang mit dem Risiko von Übergriffen oder Schäden untersucht wird, besteht die Gefahr, dass Narrative verstärkt werden, die den Opfern die Schuld geben. In Großbritannien wurde diese Dynamik durch das weit verbreitete Bild einer jungen Frau, die bewusstlos neben zwei Flaschen Alkohol auf einer Bank liegt, deutlich illustriert. Das Foto, das die Presse als »Bench Girl« betitelte, wurde als Symbol für das Alkoholproblem des Landes herangezogen – obwohl die meisten alkoholbedingten Schäden bei älteren Männern und nicht bei jungen Frauen auftreten. Eine solche Fokussierung birgt die Gefahr, dass die Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild davon bekommt, wer am stärksten gefährdet ist und warum.
Die öffentliche Reaktion auf Alkoholkonsum spiegelt oft die gleichen geschlechtsspezifischen Doppelmoralstandards wider, die auch in der Forschung zu finden sind. So löste beispielsweise das gesellige Alkoholtrinken zweier Premierminister*innen – Sanna Marin aus Finnland und Anthony Albanese aus Australien – völlig unterschiedliche Reaktionen aus. Marin wurde sowohl in Finnland als auch im Ausland scharf kritisiert, nachdem ein Video von ihr beim Feiern mit Freund*innen online gestellt worden war. Kritiker*innen verurteilten ihr Verhalten als »unangemessen für eine Premierministerin« und warfen ihr vor, sich wie eine »Ladette« (eine Frau, die sich wie ein Mann verhält) zu benehmen. Im Gegensatz dazu wurde Albanese von einer Menschenmenge angefeuert, während er ein Bier trank, wobei die Jubelrufe umso lauter wurden, je schneller er trank. Es gab keine Empörung, keine Forderungen nach einem Drogentest oder seinem Rücktritt, wie es bei Marin der Fall war.
Wohin als nächstes?
Das Forscher-Team ist der Meinung, dass das Alkoholkonsumverhalten von Männern zu wenig erforscht ist und einer gezielteren Untersuchung bedarf. Dabei geht es ihm nicht darum, das Trinkverhalten von Männern zu problematisieren, sondern es argumentiert, dass es in der Alkoholforschung künftig einen Schwerpunkt bilden sollte. Diese Argumentation stützt sich auf die in der Übersicht dargelegten Fakten, darunter die Überrepräsentation von Frauen im Verhältnis zu den von ihnen erlittenen Schäden, der Mangel an qualitativer Forschung mit Männern, die helfen könnte, ihre Trinkgewohnheiten zu verstehen, die sehr wenigen Studien über Väter, die begrenzten Studien aus den Bereichen Psychologie, öffentliche Gesundheit und Soziologie über Männer und viele andere Beispiele.
Studien zum Alkoholkonsum von Frauen sind nach wie vor wichtig und sinnvoll. Das Team möchte jedoch betonen, dass die derzeitige Fokussierung auf den Alkoholkonsum von Frauen – einschließlich der Art und Weise, wie Frauen dafür verantwortlich gemacht werden – eine Form der Problematisierung darstellt, die von Forscher*innen weiter reflektiert werden muss.
Schlussfolgerung
Das Team hofft, dass diese Übersicht Forscher*innen dazu anregt, über die Entscheidungen nachzudenken, die sie bei ihrer Forschungsarbeit treffen, insbesondere darüber, wen sie untersuchen und wie sie dies tun, und dass sie sie dazu veranlasst, die Auswirkungen ihrer Forschung auf die von ihnen untersuchten Bevölkerungsgruppen genauer zu betrachten.
Verfasst von Dr. Megan Cook, Dr. Amy Pennay, Professorin Sarah MacLean, Dr. Gabe Caluzzi, Dr. Ben Riordan, Professorin Amanda Cooklin, Alex Torney, außerordentliche Professorin Sarah Callinan, La Trobe University.
Alkoholmarketing richtet sich zunehmend an Frauen – vor allem über den Sport

Ende letzten Jahres gab der globale Getränkeriese Diageo bekannt, dass seine irische Alkoholmarke Guinness nicht nur das irische Six-Nations-Rugbyteam der Männer, sondern auch das der Frauen sponsern wird.
Dies wurde in den Medien als positiv für das aufstrebende irische Frauenteam dargestellt, aber man muss sich wirklich die Frage stellen: Warum? Warum sollte ein vernünftiger Mensch glauben, dass es eine gute Sache ist, wenn ein globaler Alkoholkonzern ein Team sponsert, zu dem vor allem Mädchen und Frauen aufschauen?
Weiterlesen: Alkoholmarketing richtet sich zunehmend an Frauen – vor allem über den Sport
Die Alkoholindustrie nutzt den Feminismus aus und kapert die Sache der Frauenrechte
Dieses Special zeigt, wie die Alkoholindustrie versucht, den Feminismus und die Selbstbestimmung der Frauen zu untergraben, indem sie sich Tage wie den Internationalen Frauentag zu Nutze macht.
Weiterlesen: Die Alkoholindustrie nutzt den Feminismus aus und kapert die Sache der Frauenrechte
Quelle: Institute of Alcohol Studies
Übersetzt mit www.DeepL.com


